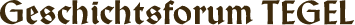Mit dem Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, endet das Kirchenjahr. Es folgt der erste Adventssonntag, mit dem alle Jahre wieder in Berlin zahlreiche Weihnachtsmärkte Jung und Alt, Berliner wie auch Besucher der Stadt, zum Bummeln einladen. Jeder von uns hat da wohl bestimmte Märkte, die er besonders gern aufsucht. Mit den Weihnachtsmärkten am Schloss Charlottenburg, an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, auf den Gendarmenmarkt, am Roten Rathaus, in Alt-Rixdorf, in Britz oder in Spandau seien nur ganz wenige genannt. Nicht zu vergessen zudem die Weihnachtsmärkte und -basare der Kirchengemeinden in Reinickendorf und den anderen Bezirken Berlins.
 Ganz anders als in heutiger Zeit ging es natürlich im 19. Jahrhundert auf dem (einzigen) Berliner Weihnachtsmarkt in der Breite Straßen und auf dem Schlossplatz zu. Wenn man so will, begann die Weihnachtszeit schon Anfang Dezember damit, dass schwarzgekleidete Kurrenden durch die Straßen und Hinterhöfe zogen und Weihnachtslieder sangen. Wehmütige Blicke richteten sie zu den Fenstern, milde Gaben der Bewohner erbittend. Am Vortag des 11. Dezember jubelte dann die liebe Jugend der ´Klipp- und Pantinenschulen´ und anderer Bildungsanstalten: „Hurrah, heute werden die Buden aufgebaut!“
Ganz anders als in heutiger Zeit ging es natürlich im 19. Jahrhundert auf dem (einzigen) Berliner Weihnachtsmarkt in der Breite Straßen und auf dem Schlossplatz zu. Wenn man so will, begann die Weihnachtszeit schon Anfang Dezember damit, dass schwarzgekleidete Kurrenden durch die Straßen und Hinterhöfe zogen und Weihnachtslieder sangen. Wehmütige Blicke richteten sie zu den Fenstern, milde Gaben der Bewohner erbittend. Am Vortag des 11. Dezember jubelte dann die liebe Jugend der ´Klipp- und Pantinenschulen´ und anderer Bildungsanstalten: „Hurrah, heute werden die Buden aufgebaut!“
Mit dem Aufbau der Marktbuden nahm die Weihnachtsvorfreude ihren Lauf. Allerdings gewann das Weihnachtsbild erst wenige Tage später, am ersten folgenden Sonntag, seine rechten Farben und Lichter. In engen Budenreihen drängten die Besucher. Das Geschrei kleiner, sich rechtzeitig „in der Kunst Merkurs übender Verkäufer“ wurde immer lauter, Knarren und Waldteufel brummten, dass einem „Hören und Sehen verging“.
Selbst aus den entfernteren Straßen Berlins machten sich viele Familien, voran das Oberhaupt am Arm der treuen Hälfte, zu Fuß auf den Weg in Richtung Innenstadt, dabei immer dem „strahlenden Glanz“ von Öllampen und Talgkerzen folgend. Im Fahren war der Berliner ehedem sparsam, zumal die Droschkenvehikel als unpraktisch galten. Der Hauptstrom der Schaulustigen kam von der Langen- oder Kurfürstenbrücke her. In Erwartung all des Schönen und Herrlichen schwelgte man bereits in der Königstraße (heutige Rathausstraße). Schloßplatz Nr. 9 war das Galanteriewarengeschäft von Fiocati, vor dem Halt gemacht wurde. Alles hier Ausgestellte des Königlichen Hoflieferanten fand ungeteilte Bewunderung. In der Burgstraße nahe Königstraße hatten die Gebrüder Kirchmayr das größte Spielwarengeschäft der Stadt. Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt auch hier und da Tische, auf denen neben einer Laterne in Reih´ und Glied die damals typischen Figuren der Sägemänner, Schornsteinfeger und Rosinenmänner auf Käufer warteten. Aus Holzgestellen gefertigte Pyramiden, mit Papierstreifen in allen bunten Farben beklebt, konnten erworben werden. Sie hatten damals noch den Vorzug vor den sich später durchsetzenden Tannenbäumen.
Angefertigt wurden diese Weihnachtsgegenstände von den im Winter „feiernden“ Bauhandwerkern, Maurern und Zimmererleuten, die mit dem kärglichen Verdienst ihr Leben fristeten. In der Breite Straße befanden sich übrigens zum Ärger der dortigen Ladenbesitzer auch „Prachtbuden“ großer Hauptgeschäfte der Stadt, denen sogar der Wagenverkehr gestattet war.
 Viel beachtet wurden auch die Schaufenster der Konditoreien. Sie hatten aus Zuckerwerk hergestellte Figurentheater ausgestellt. Als Mittelpunkt des „verfeinerten“ Weihnachtsvergnügens galt die Ausstellung bei Gropius. Wer Gropius nicht besucht hatte, so hieß es, der war von der Berliner Weihnachtsfreude nur unvollständig unterrichtet. Hier drängten sich die „kleinen“ und die „feinen“ Leute in einem engen Raum, kauften einige Kleinigkeiten. Doch alle hielten sich am liebsten bei den stummen Musikanten auf, die mit spaßhaften automatischen Bewegungen die Besucher köstlich unterhielten. Als dann später erste Musikanten aus Paris eintrafen, lockten die Klänge der Musik weitere Scharen Neugieriger an. Zu Beginn der 1870er Jahre wurden die großen Weihnachtsausstellungen der Gebrüder Castan in ihrem in der Passage gelegenen Panoptikum gut besucht.
Viel beachtet wurden auch die Schaufenster der Konditoreien. Sie hatten aus Zuckerwerk hergestellte Figurentheater ausgestellt. Als Mittelpunkt des „verfeinerten“ Weihnachtsvergnügens galt die Ausstellung bei Gropius. Wer Gropius nicht besucht hatte, so hieß es, der war von der Berliner Weihnachtsfreude nur unvollständig unterrichtet. Hier drängten sich die „kleinen“ und die „feinen“ Leute in einem engen Raum, kauften einige Kleinigkeiten. Doch alle hielten sich am liebsten bei den stummen Musikanten auf, die mit spaßhaften automatischen Bewegungen die Besucher köstlich unterhielten. Als dann später erste Musikanten aus Paris eintrafen, lockten die Klänge der Musik weitere Scharen Neugieriger an. Zu Beginn der 1870er Jahre wurden die großen Weihnachtsausstellungen der Gebrüder Castan in ihrem in der Passage gelegenen Panoptikum gut besucht.
Heute wird weit mehr geboten, es ist alles ins Große hinein gewachsen; der patriarchalische Zug jener Zeit ist längst nicht mehr, mit ihm aber auch ein Stück von jener Poesie verschwunden, die aller Glanz und aller Luxus nicht ersetzen können. Mit dieser Bemerkung endete eine Beschreibung der Berliner Weihnachtszeit um 1850, die ein namentlich nicht genannter Verfasser zu Beginn des 20. Jahrhunderts schilderte. Der Inhalt wurde sinngemäß übernommen.
Vom Weihnachts-Aberglauben der Berliner
In der Vergangenheit war in weiten Kreisen der Berliner Bevölkerung der tiefe Glaube an allerlei übernatürliche Dinge verbreitet. Hier von den teils uralten Überlieferungen eine kleine „Blütenlese“ dessen, was zumindest noch in den 1880er Jahren in der Weihnachtszeit beachtet wurde:
- Die Wäscheleine durfte vom Weihnachtsabend bis Neujahr nicht auf dem Wäscheboden hängen bleiben, weil sonst großes Unglück geschah.
- Am Weihnachtsabend mussten Rogen-Karpfen gegessen werden. Fisch-Rogen bedeutete nämlich Geld. Arme Leute, die sich keinen Karpfen leisten konnten, kauften einen Hering mit Rogen.
- Fischschuppen vom Weihnachtskarpfen im Portemonnaie bedeuteten das ganze Jahr über Geld.
- Alle Träume, die man zwischen Weihnachten und Neujahr hatte, gingen in Erfüllung.
- Kinder, die in der Christnacht geboren wurden, hatten die Gabe der Prophezeiung.
- Makaber der letzte hier genannte Aberglaube: Am Weihnachtsabend füllte jedes Familienmitglied einen Fingerhut mit Sand. Der Sand kam dann als Häufchen auf ein Stück Papier. Derjenige, dessen Sandhäufchen am Morgen des ersten Feiertages zusammengefallen vorgefunden wurde, stirbt im nächsten Jahr.
Wem kommt vielleicht auch heute noch bekannt vor, „zwischen den Jahren“ keine Wäsche zu waschen und eine Fischschuppe des Silvesterkarpfens in die Geldbörse zu legen? Zum Aberglauben mit dem Sand im Fingerhut ist nicht überliefert, ob sich Familien überhaupt diesem Risiko aussetzten.
Gerhard Völzmann