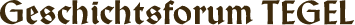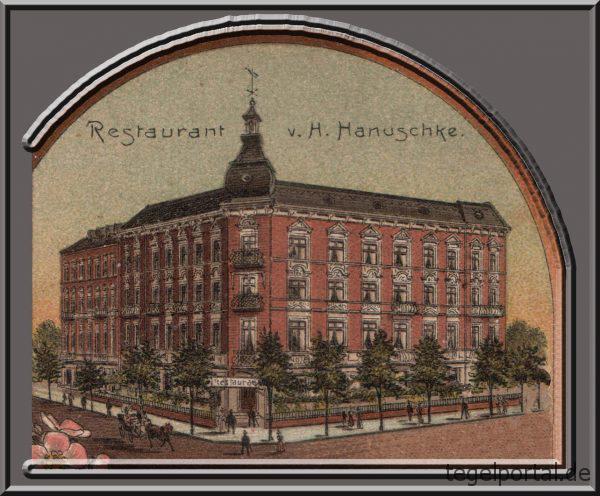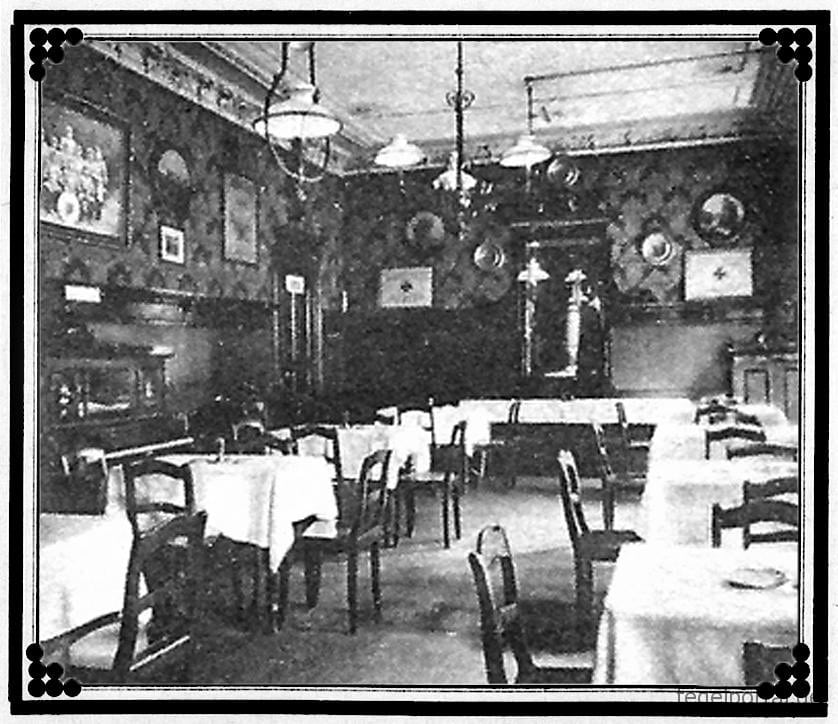Das einstige Gaswerk der Gemeinde Tegel (Gaswerk Tegel AG) ist nicht mit dem Werk Tegel der Berliner Städtischen Gaswerke AG zu verwechseln. Das erstgenannte Werk befand sich in der Gaswerkstraße 4 – 5 (heutige Ernststraße), während die Städtischen Werke unter der Anschrift Berliner Straße 48 – 60 zu erreichen waren.
Doch zunächst ein Rückblick auf die Tegeler Straßenbeleuchtung bis zum Jahre 1896. Dem Niederbarnimer Kreisblatt v. 20.9.1876 war zu entnehmen, dass in Tegel „vor Kurzem“ eine Straßenbeleuchtung eingerichtet wurde. Es war eine Petroleumbeleuchtung. Die Laternenmaste waren aus Holz. Die Zahl Laternen wurde vom Herbst 1889 bis Mitte Okt. 1890 um 25 Stück vermehrt. Zur Unterhaltung der Beleuchtung wurden in erster Linie die Einnahmen aus der Hundesteuer verwendet.
Zum Leidwesen der Gemeindeverwaltung wie auch der Einwohner wurden die Laternen immer wieder beschädigt. So berichtete die neue Vorort-Zeitung am 18.8.1894:
Tegel. Am letzten Montag tagte hier die Gemeinde-Vertretung und wurde beschlos-sen, dem Unternehmer Karl Franke aus Bremen die Konzession zur Erbauung und zum Betriebe eines Gaswerkes für Tegel zu ertheilen. Mit dem Bau, zu dem der poli-zeiliche Konsenz nachgesucht ist, soll baldigst begonnen werden, sodaß das Gas-werk schon zum nächsten Winter in Betrieb gesetzt werden kann.
Am 3.3.1896 teilte der Tägliche Anzeiger für die Gemeinde Hermsdorf seinen Lesern folgendes mit:
Tegel. Am letzten Montag tagte hier die Gemeinde-Vertretung und wurde beschlossen, dem Unternehmer Karl Franke aus Bremen die Konzession zur Erbauung und zum Betriebe eines Gaswerkes für Tegel zu ertheilen. Mit dem Bau, zu dem der polizeiliche Konsenz nachgesucht ist, soll baldigst begonnen werden, sodaß das Gaswerk schon zum nächsten Winter in Betrieb gesetzt werden kann.
Am 14.4.1896 berichtete die Zeitung, dass die Gasanstalt bereits im Bau sei und zum 1.9. d. J. in Betrieb gesetzt werden soll. Der Bauplatz lag nordöstlich der Chaussee (Berliner Straße) dicht neben der neuen Borsigschen Fabrikanlage.
Der Errichtung des Gaswerkes lag ein Vertrag zu Grunde, der am 13.3.1896 zwischen dem Bremer Carl Francke und dem Gemeinde-Vorstand Tegel abgeschlossen wurde. Der Kreis-Ausschuss des Kreises Nieder-Barnim hatte ihn am 12.3.1896 den Beschlüssen der Gemeinde-Vertretung Tegel v. 24.2. und 10.3.1896 entsprechend genehmigt. Es lohnt sich, den Vertrag einmal näher anzusehen.
 Danach übernahm Francke die Herstellung und den Betrieb einer Steinkohlengasanstalt nebst Straßenrohrnetz mit Laternen auf eigene Rechnung. Öffentliche Gebäude und Privatwohnungen waren mit Gas zu versorgen. Gas-Zuleitungen mussten bis 3 m hinter der Baufluchtlinie hergestellt werden.
Danach übernahm Francke die Herstellung und den Betrieb einer Steinkohlengasanstalt nebst Straßenrohrnetz mit Laternen auf eigene Rechnung. Öffentliche Gebäude und Privatwohnungen waren mit Gas zu versorgen. Gas-Zuleitungen mussten bis 3 m hinter der Baufluchtlinie hergestellt werden.
Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 25 Jahren, gerechnet vom Tag des Beginns der öffentlichen Beleuchtung. Der Unternehmer verpflichtete sich, bis zum 1.4.1897 die Anlage zu vollenden und die vorgesehenen Straßen und Plätze mit Gas zu beleuchten. Für das Rohrleitungssystem mussten eiserne Röhren verwendet werden.
§ 7 Abs. 2 des Vertrages lautete: Wenn infolge eines Straßenauflaufes oder Tumultes Beschädigungen der öffentlichen Beleuchtungskörper vorkommen, soll die Gemeinde nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz der Wiederherstellungskosten verpflichtet sein“.
 Als durchschnittliche Brennzeit jeder öffentlichen Laterne wurden 1500 Brennstunden festgelegt. Mindestens 200 Straßenlaternen waren geplant. Weniger als 2 Brennstunden je Laterne und Tag durften nicht verlangt werden.
Als durchschnittliche Brennzeit jeder öffentlichen Laterne wurden 1500 Brennstunden festgelegt. Mindestens 200 Straßenlaternen waren geplant. Weniger als 2 Brennstunden je Laterne und Tag durften nicht verlangt werden.
Laternen brannten damals nicht etwa vom Eintritt der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Vielmehr richtete sich die Brennzeit im Wesentlichen nach einem jährlich zu erlassenden Brennkalender. Hierin wurden die Brennstunden, die „mit Sicherheit“ bestimmbar waren, eingetragen. Der Gemeinde-Vertretung war es freigestellt, Änderungen vorzunehmen. So konnte durchaus auch eine regelmäßige Nachtbeleuchtung einer beschränkten Anzahl von Laternen bestimmt werden, die dann von 11 Uhr abends bis zum Tagwerden leuchteten.
Sämtliche Laternen mussten vertraglich spätestens 30 Minuten nach der vereinbarten Zeit angezündet sein. Anderenfalls musste Unternehmer Francke eine Konventionalstrafe von 10 Pf. pro Laterne zahlen. Ausnahmen galten nur bei mutwilliger Beschädigung, heftigem Sturm, Regen, Frost oder Schneetreiben, also bei Erschwernissen für den Laternenanzünder.
Zur Straßenbeleuchtung sollte nur Gasglühlicht von mindestens 30 Kerzen Stärke verwendet werden. Zudem sollte die Leuchtkraft des Gases bei 140 Liter Konsum im Argandbrenner1 pro Stunde gleich der Leuchtkraft von 14 Normalkerzen sein. Sollte der Unternehmer die Lichtstärke nicht erreichen, musste er ohne zusätzliche Vergütung die Gasmenge erhöhen.
„Die bei der Fabrikation des Gases gewonnenen übelriechenden Produkte sind so aufzubewahren, dass sie der Umgebung weder schädlich noch lästig werden“, lautete § 15 a. a. O.
Natürlich war auch geregelt, welche Beträge Francke für seine Leistungen erhielt: 25 Mark waren für je 1000 Brennstunden einer Straßenlaterne zu zahlen. Ein Mehrverbrauch wurde entsprechend vergütet. 4 Pf. pro Brennstunde und Flamme fielen an, wenn einzelne Laternen außerhalb der üblichen Brennstunden betrieben wurden.
Für Privatpersonen sollte Leuchtgas nicht über 18 Pf. je Kubikmeter kosten, für Motoren, Heiz- und Kochgas nicht über 12 Pf. Dem Unternehmen war eine Anpassung des Privatgaspreises um 2 Pf. pro m3 zugestanden, wenn die Preise für „gu- te Gaskohlen“ den Normalsatz von 200 Mark pro 10 000 Kilo franko Gaswerk um ein Fünftel übersteigen sollten.
Carl Francke wurde vertraglich zugesichert, dass keinem anderen Unternehmen die Befugnis des Gasverkaufs erteilt werde. Dritte durften weder unter- noch oberirdisch Leitungen für Elektrizität legen und für eine Erleuchtung nutzen.
Nach Ablauf des Vertrages war die Gemeinde Tegel befugt, diesen um jeweils 10 Jahre zu verlängern, musste dies aber 2 Jahre vorher kundtun. Im Falle einer Abstandnahme hiervon seitens der Gemeinde musste diese das Werk zur Hälfte des Tax- und Geschäftswertes kaufen.
Die Kaution, die Francke zur Erfüllung seiner Verpflichtungen hinterlegen musste, betrug 10 000 Mark.
Wohl mit Bedacht stand im Vertrag abschließend: Sollte zum Betriebe des Gaswerks eine Aktiengesellschaft gebildet werden, dann behält sich die Gemeinde Tegel das Recht der Teilnahme an der Verwaltung der Aktiengesellschaft vor; ihr sind zu diesem Zwecke mindestens zweitausend Mark Aktien zum Nominalwert zuzuweisen und ein Vertreter der Gemeinde Tegel muß dem Aufsichtsrat mit Sitz und Stimme angehören.“
Tatsächlich trat Francke bereits am 24.4.1896 seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag an die Aktiengesellschaft Gaswerk Tegel ab.
Die Gasbereitungs- und Gasbewahranstalt wurde laut Verhandlung vom 13.11.1896 als errichtet und dem Betrieb übergeben festgestellt. Die Gasleitungsröhren waren gelegt, die Laternen aufgestellt. Die öffentliche Gasbeleuchtung in den Straßen Tegels begann also am 13.11.1896, der Vertrag v. 13.3.1896 bekam danach Gültigkeit bis zum 13.11.1921. In der Verhandlung wurde auch festgestellt, dass die Zahl der Straßenlaternen noch zu mehren sei, zudem waren noch einige Leitungen erforderlich.
In der Folgezeit dehnte die Gaswerk Tegel AG ihre Gaslieferungen aus. So wurden
-
Wittenau und Borsigwalde ab Oktober 1900,
-
Waidmannslust ab Juli 1901,
-
Hermsdorf ab August 1901 und
-
Lübars ab Oktober 1905
mit Gas aus Tegel versorgt.
Im Jahre 1902 kam es vor dem Berliner Schöffengericht zu einem Verfahren wegen Diebstahls. Angeklagt waren der Gastwirt und Gemeindevertreter F. Kulina aus der Egellsstraße und der bei der Gaswerk Tegel AG tätige Arbeiter Müller. Was war der Grund? Im letzten Winter wurde in Tegel längere Zeit über eine ungenügende Straßenbeleuchtung gesprochen. Es wurde gemunkelt, dass das Gaswerk die Düsen in den Laternen verengt habe, damit der Gasverbrauch abnehmen würde. Als Gemeindevertreter wollte Kulina den Wahrheitsgehalt dieses Gerüchtes überprüfen. Durch Müller ließ sich Kulina einige Düsen alter und neuer Konstruktion besorgen, die er dann dem Haus- und Grundbesitzerverein vorlegte. Tatsächlich zeigte sich, dass das Gaswerk hier eine „Sparsamkeit“ entwickelt hatte. Der bei der Sitzung anwesende Gendarm erstattete dem Amtsvorsteher Bericht über diesen Sachverhalt mit der Folge, dass gegen Müller Anklage wegen Diebstahls und gegen Kulina gleiches wegen Verleitung zum Diebstahl erhoben wurde. Das Schöffengericht sprach zwar beide Angeklagte frei, doch der Arbeiter Müller wurde vom Gaswerk sofort entlassen.
Der Prozeß zeigt, wie vor den Thoren Berlins Gemeindeverordnete behandelt werden, die Interesse für kommunale Fragen bekunden. So das Fazit damaliger Zeit zu diesem Vorgang.
Das Tegeler Gaswerk verfügte im Jahre 1905 vor Beginn der Gaslieferung nach Lübars über ein Gesamtrohrnetz von 66,97 km Länge und produzierte über eine Million Kubikmeter Gas. In Hermsdorf, das ein Rohrnetz von 17,35 km Länge hatte, gab es am 1.4.1905 312 Gasabnehmer mit 577 Gasmessern. Hier wurden 91598 m3 Leuchtgas, 82934 m3 Heizgas und 26108 m3 Gas für die Straßenbeleuchtung verbraucht. Der Ort hatte 126 – 134 Laternen mit 187205 Stunden Brenndauer in Betrieb. Der Gesamtverbrauch von 200640 m3 Gas bedeutete für das Tegeler Gaswerk 16 Prozent der Gesamtabgabe an Gas.
Dalldorf mit Borsigwalde stand dem größeren Hermsdorf nicht viel nach. Hier war das Rohrnetz sogar 19,26 km lang. Der Verbrauch lag bei 72688 Kubikmeter Leuchtgas, 41814 m3 Heizgas und 34963 m3 Gas für die Straßenbeleuchtung. Es gab 203 Gasabnehmer und 302 Gasmesser. 190 – 204 Laternen brannten an 244337 Stunden. Mit dem Gesamtverbrauch von 149465 m3 Gas in Dalldorf und Borsigwalde erzielte das Gaswerk in Tegel eine Abgabe von 11.8 Prozent seiner Gesamtmenge.
Die genannten Zahlen bedeuteten eine große Steigerung des Gaskonsums und machten eine Vergrößerung des Werkes erforderlich. 1905 wurde mit der Erweiterung begonnen, die zu einer Verdoppelung der Leistungsfähigkeit führte.
Im gleichen Jahr wurden die zwischen der Tegeler Gemeindevertretung und dem Gaswerk entstandenen Differenzen durch einen Vergleich beigelegt. Es ging um die Höhe des Gaspreises. Die Gasanstalt hatte sich vertraglich verpflichtet, den Preis für Leuchtgas von 17 auf 16 und den für Kochgas von 11 auf 10 Pfennig herabzusetzen, sobald der Gesamtumsatz 1 Million m3 Gas beträgt. Durch Anschluss von Nachbargemeinden wurde die Umsatzhöhe erreicht, diesen Orten auch der ermäßigte Gaspreis eingeräumt. Tegel erhielt diesen Preis jedoch nicht. Es hieß, die Gemeinde müsste allein die Grenze von 1 Million m3 erreichen. Der Vertrag ließ hierüber Zweifel offen. So kam es zu dem Vergleich, den ermäßigten Preis (erst) zum 1.4.1906 einzuführen. Im April 1907 hätte Tegel wohl allein die Umsatzhöhe erreicht.
Am 15.10.1907 endete die Gasversorgung Hermsdorfs durch das Tegeler Gaswerk. Die dortige Gemeinde nahm nämlich am Folgetag ihr selbst errichtetes Gaswerk in Betrieb. Für die Hermsdorfer verbilligte sich dadurch der Gaspreis. Bisher kostete das Leuchtgas der Tegeler Gasanstalt 15 Pfennig und das Kochgas 10 Pfennig pro Kubikmeter, während das Hermsdorfer Werk für Leucht- und Kochgas einheitlich 13 Pfennig pro Kubikmeter berechnete.
1908 verzeichnete das Tegeler Gaswerk eine nicht so günstige Entwicklung, wie dies noch im Vorjahr der Fall war. Die Zahl an weiteren Konsumenten wie auch die der Gasabgabe hatte merklich nachgelassen. Das lag an der geringen Bautätigkeit, der „flauen“ Geschäftslage und der Sparsamkeit der Verbraucher. Die „kleinen Leute“ vermieden Ausgaben, die nicht unbedingt nötig waren.
Allerdings hielt sich der Gasverbrauch auf der Höhe des Jahres 1907, die Industrie verbrauchte sogar mehr. Der Kokspreis lag unter dem des Vorjahres; Teer hatte einen niedrigen Preis und war schwer zu verkaufen. Lebhaft verlangt wurde hingegen zu einem annehmbaren Preis verdichtetes Ammoniakwasser. Der Kohlenpreis war recht hoch. Insgesamt bezeichnete die Gaswerk Tegel AG das Geschäftsjahr 1908 als befriedigend.
Eine gewaltige Explosion ereignete sich am 2.10.1911 gegen 5 Uhr in der Frühe. Im Maschinenhaus der Gasanstalt, das mit dem zur Reinigung des Gases dienenden Apparateraum in direkter Verbindung stand, verrichten der 38-jährige Maschinenwärter Adolf Reuß (verheiratet und Familienvater) und die beider Heizer Schubert und Prochnow ihre Arbeit. Gerade hatten die Heizer sich zu einer Pause in den nebenan liegenden Arbeitsraum begeben, als sich im Maschinenhaus eine gewaltige Explosion ereignete. Die weithin hörbare Detonation löste bei der Tegeler Feuerwehr und den Wehren des Borsigwerkes und denen der umliegenden Ortschaften Alarm aus. Als die Feuerwehren in der Gaswerkstraße eintrafen, stand das Maschinenhaus in Flammen. Die fast 20 m lange Gebäudewand zur Straßenseite hin war eingestürzt. Der Maschinenwärter Reuß lag besinnungslos und schwer verletzt auf der Straße. Der Luftdruck hatte ihn zusammen mit den Trümmermassen über einen Drahtzaun hinweg mitten auf die Straße geschleudert. Sein Unterschenkel war gebrochen, Gesicht und Hände schwer verbrannt, wie sich später herausstellte. Rettungsmannschaften brachten ihn zum Paul-Gerhardt-Stift in der Müllerstraße.
Die beiden Heizer im Nachbarraum des Maschinenhauses wurde durch die Steine der eingestürzten Trennungswand begraben. Sie konnten sich aber selbst befreien und kamen mit leichten Quetschwunden und Kontuflouen davon.
Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen, die auch bereits in der Nähe aufgestapelte Kohlen erfasst hatten. Es bestand zudem die Gefahr, dass die Gasbehälter explodierten. Ursache war, dass aus einem kleinen Hahn des Gasreinigers fortgesetzt Gas ausströmte und sich zu einer Stichflamme entzündete. Der Reinigungsbehälter war bereits eingebeult. Drei mutige Feuerwehrleute, unter ihnen Brandinspektor Gläser, der damalige Leiter derFeuerwehr der Fa. Borsig, kletterten über den Reiniger auf das Dach und kühlten dort, großer Hitze ausgesetzt, durch einen Wasserstrahl die angegriffene Stelle des Behälter-Mantels. Sie konnten eine Explosion verhindern.
Schlimm sah es in der Maschinenhalle aus. Maschinen-Saugapparate, Motoren, Exhauster waren stark beschädigt; der Betrieb musste eingestellt werden. Fensterscheiben der Maschinenhalle und der umliegenden Gebäude waren zersplittert. Merkwürdig war der Verlauf der Explosion. Maschinenhäuser in Gasanstalten tragen nämlich nur leichte Holzdächer, damit im Falle einer Explosion die Gase einen Ausweg finden und nur geringe Massen herabstürzen. Hier erfolgte die Explosion aber in seitlicher Richtung. Das Dach blieb unbeschädigt.
Für den Abend und die Nacht wurden in Tegel wie in den mitversorgten Ortschaften durch verringerte Gaszufuhren Einschränkungen bis hin zur Straßenbeleuchtung befürchtet. Dies geschah jedoch nicht, weil das Gaswerk VI der Stadt Berlin Energie lieferte.
Ausführliche Informationen liegen mit den Geschäftsberichten für die Zeit v. 1.4.1911 – 31.5.1913 vor, dem 16. und 17. Betriebsjahr des Gaswerkes. Danach konnte 1911/12 eine größere Zunahme sowohl der Gasabnehmer wie auch des Gasverbrauchs gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Die Einkaufspreise für „Gaskohlen“ erhöhten sich, die Verkaufspreise für Koks fielen. Alle Nebenprodukte fanden einen guten Absatz, so dass keine Lagervorräte vorhanden waren. Misslich war die (zuvor geschilderte) Explosion. Zwar wurde die Gaserzeugung nur für kurze Zeit unterbrochen, war aber bis kurz vor Weihnachten erheblich eingeschränkt. 14,66 Prozent der Jahresmenge musste das Werk vom Gaswerk VI der Stadt Berlin zu einem Preis beziehen, der den der eigenen Erzeugungskosten erheblich überstieg. Trotzdem war man für die Kooperation dankbar.
Das Betriebsjahr 1912/13 ergab wieder eine Zunahme der Gasabnehmer und des -verbrauchs. Die Einkaufspreise für „Gaskohlen“ stiegen und führten zu etwas höheren Verkaufspreisen für Koks.
Folgende Zahlen sind überliefert:
|
1911/12 |
1912/13 |
|
|
Entgaste Kohlenmenge |
8332 t |
10018 t |
|
Zur Verfügung stehendes Gas |
2726400 m3 |
2848700 m3 |
|
Erzeugter Koks |
5582 t |
6712 t |
|
Erzeugter Teer |
346 t |
450 t |
|
Gasabgabe an die Verbraucher |
2313000 m3 |
2475000 m3 |
|
Gasverbrauch für die Straßenbeleuchtung |
215350 m3 |
229600 m3 |
|
Zahl der Gasabnehmer am 1. April |
3240 |
3410 |
|
Zahl der Gasmesser |
5680 |
5950 |
|
Gesamter Koksverkauf |
4300 t |
5090 t |
|
Teerverkauf |
365 t |
433 t |
|
Einkaufspreis für Kohle pro Tonne |
17-19,10 Mk. |
22,52 Mk. |
|
Verkaufspreis für Koks pro Tonne |
17-19,10 Mk. |
19-22,50 Mk. |
|
Verkaufspreis für Teer pro Tonne |
22,50 Mk. |
22,50 Mk. |
|
Verkaufspreis für Ammoniakwasser pro kg |
0,78 Mk. |
1 Mk. |
Für das Geschäftsjahr 1911/12 lassen sich die zuvor in der Tabelle genannten Zahlen teilweise noch wie folgt aufteilen:
|
Tegel |
Lübars |
|
|
Leuchtgas an Private |
921778 m3 |
354091 m3 einschl. Heiz- u. Kraftgas |
|
Heiz- und Kraftgas an Private |
1037305 m3 |
— |
|
Straßenbeleuchtung, Brennstunden |
1132012 |
260772 |
|
Straßenbeleuchtung, Gasmenge |
172668 m3 |
42672 m3 |
Ebenfalls 1911/12 war es für das Gaswerk teilweise schwierig, den laufenden Bedarf an „Gaskohlen“ zu decken. Das lag an einem „ständigen sehr großen Wagenmangel der Eisenbahnen. Teilweise mussten Gelegenheitskäufe getätigt werden, die zwar pünktlich geliefert wurden, aber auch teurer waren.
 Hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse ist folgende Passage im Bericht interessant:
Hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse ist folgende Passage im Bericht interessant:
Die Arbeitslöhne sind ebenfalls nicht unerheblich gestiegen, die Willigkeit und Arbeitsfreudigkeit der Arbeiter jedoch geringer geworden, so daß der Geschäftsgang leidet und man gezwungen ist, sich durch maschinelle Einrichtungen unabhängiger zu machen. Diesem Streben wird von der Arbeiterschaft ständig entgegengewirkt.
Hierzu passt der weiter unten aufgeführte Zeitungsartikel über die Arbeitsbedingungen.
Der Haushaltsplan der Gemeinde Tegel veranschlagte für das Rechnungsjahr 1914 an Einnahmen des Gaswerkes:
-
Private und Behörden 355 000 Mark
-
Öffentliche Beleuchtung (Tegel 36 000 M., Lübars 6 600 M.) 42 600 Mark
-
Selbstverbrauch 8 000 Mark
-
Gasverlust 12 000 Mark.
Das Gaswerk erwirtschaftete danach bei veranschlagten Einnahmen von 963 600 Mark und erwarteten Ausgaben von 907 689,15 Mark einen Gewinn von 55 910,85 Mark
Die regelmäßige Straßen- und Wegebeleuchtung kostete (siehe oben) 36 000 Mark.
Am 18.3.1914 berichtete eine Zeitung :
Arbeitsverbesserungen im Gaswerk zu Tegel. Einen bemerkenswerten Erfolg erzielten die seit kurzer Zeit organisierten Arbeiter der Gemeindegaswerkes in Tegel bei Berlin. Bisher bestand für die Retortenarbeiter der 18stündige Schichtwechsel. Eine der ersten
Forderungen der jungen Organisation war die Beseitigung dieser unmenschlichen Arbeitszeit. Die Anträge der Organisation sind insofern von Erfolg gekrönt, als die 18stündige Wechselschicht beseitigt worden ist. An ihre Stelle tritt an Schichtwechseltagen die zwölfstündige Schicht, die weitergehenden Anträge auf Einführung der achtstündigen Schicht, die in Groß-Berlin allgemein besteht, harrt noch ihrer Erledigung.
Nach der Eingemeindung Tegels zu Groß-Berlin (1.10.1920) wurden viele gemeindeeigene Versorgungsbetriebe stillgelegt, so auch die Gaswerk Tegel AG im Jahre 1921. Während der Gasbehälter abgerissen wurde, blieben das Wohnhaus (heute Ernststraße 3 a) sowie die Fabrikhalle erhalten. In letzterer befand sich von 1923 – 1931 ein Konsum für die Beschäftigten der Fa. Borsig. Zuletzt (1972) als Tanzlokal unter dem Namen „count down“ genutzt, brannte die gesamte Grundfläche von rund 1000 qm in den frühen Morgenstunden des 8.2.1972 aus. Die Tegeler Feuerwehr musste sämtliche Türen mit Gewalt öffnen. Durch den Brand stürzte ein Teil der stählernen Dachkonstruktion ein. Der Brand war nach 2 ½ Stunden unter Kontrolle, das Gebäude völlig zerstört. Menschen kamen aber nicht zu Schaden.
1 Ursprünglich für Öllampen konstruiert. Ringförmiger Gasaustritt durch feine Löcher zur Erhöhung der Leuchtkraft.