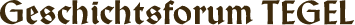Mit der (Wieder-) Eröffnung des Strandbads Tegelsee durch die neu gegründete Strandbad Tegelsee gGmbH findet eine Tradition ihre Fortsetzung, die 1932 ins Leben gerufen wurde. Je nach Betrachtungsweise könnte man auch an eine über 100 Jahre alte Tradition denken. Mehr hierzu im folgenden Artikel, der aufzeigen soll, wann einst in Tegel ein Badebetrieb entstand, dass in Wassernähe gern gezeltet wurde und dass dann das heutige Strandbad Tegelsee entstand.
 Unser Rückblick beginnt im ausgehenden 19. Jahrhundert. In Tegel, Hauptstraße 21 (heute wäre dies Alt-Tegel 45), wurde auf einem großen Grundstück 1861 die „Schwartkopffsche Villa“ errichtet. Bereits im Mai 1872 konnte sie für den Sommer des genannten Jahres gemietet werden. Die „hart am See“ gelegene Besitzung kaufte Ende der 1880er-Jahren der Unternehmer Friedrich Hanncke. Bevor er im Dezember 1892 seinen Wohnsitz und seine Treibriemenfabrik vom Wedding nach Tegel verlegte, bot auch er die Villa für Sommeraufenthalte an. In entsprechenden Zeitungsanzeigen war ein „Bad vor der Thür“ (Mai 1889) bzw. ein „Herren- und Damenbad vor der Thür“ (April 1890) angegeben. Damit ist überliefert, dass es zumindest ab 1889 eine Badeanstalt am Tegeler See gab. Wann sie errichtet wurde, ließ sich bisher nicht ermitteln. Das Herren- und Damenbad mit Umkleiden, zwei Badebecken und auch Bootsverleih war wohl vom Beginn an im Besitz der Familie Siebert. Ein W. Siebert war ganz in der Nähe ab 1875 bis zumindest 1879 als Pächter einer Schankbude auf dem Ziekowschen Grundstück am Zugang zum Tegeler See. Hier entstand schon bald das gut besuchte „See-Restaurant“. Die Badeanstalt wurde seit 1901 (und wohl auch schon zuvor) von der verwitweten Auguste Siebert betrieben.
Unser Rückblick beginnt im ausgehenden 19. Jahrhundert. In Tegel, Hauptstraße 21 (heute wäre dies Alt-Tegel 45), wurde auf einem großen Grundstück 1861 die „Schwartkopffsche Villa“ errichtet. Bereits im Mai 1872 konnte sie für den Sommer des genannten Jahres gemietet werden. Die „hart am See“ gelegene Besitzung kaufte Ende der 1880er-Jahren der Unternehmer Friedrich Hanncke. Bevor er im Dezember 1892 seinen Wohnsitz und seine Treibriemenfabrik vom Wedding nach Tegel verlegte, bot auch er die Villa für Sommeraufenthalte an. In entsprechenden Zeitungsanzeigen war ein „Bad vor der Thür“ (Mai 1889) bzw. ein „Herren- und Damenbad vor der Thür“ (April 1890) angegeben. Damit ist überliefert, dass es zumindest ab 1889 eine Badeanstalt am Tegeler See gab. Wann sie errichtet wurde, ließ sich bisher nicht ermitteln. Das Herren- und Damenbad mit Umkleiden, zwei Badebecken und auch Bootsverleih war wohl vom Beginn an im Besitz der Familie Siebert. Ein W. Siebert war ganz in der Nähe ab 1875 bis zumindest 1879 als Pächter einer Schankbude auf dem Ziekowschen Grundstück am Zugang zum Tegeler See. Hier entstand schon bald das gut besuchte „See-Restaurant“. Die Badeanstalt wurde seit 1901 (und wohl auch schon zuvor) von der verwitweten Auguste Siebert betrieben.
Im Juli 1901 forderte der Tegeler See an einem Tag gleich von zwei Männern das Leben, die die Siebertsche Badeanstalt besuchten. Ein Techniker aus Berlin fuhr mit seiner Braut nach Tegel. Während er zum genannten Bad ging, wartete das junge Mädchen im „See-Restaurant“ auf ihn. Nach zwei Stunden hielt sie bei Frau Siebert Rücksprache nach dem Verbleib ihres Bräutigams. Dabei erfuhr sie, dass die Besitzerin der Badeanstalt gerade den Amtsvorsteher über den Tod eines Badegastes unterrichtet hatte, der zu weit in den See hinausgeschwommen und ertrunken war. Der Verunglückte war ihr Bräutigam. Auch ein Geschäftsmann aus Berlin, Vater von acht Kindern, schwamm an demselben Tag von der Siebertschen Badeanstalt aus eine Strecke in den Tegeler See und kehrte nicht mehr zurück.

Badeanstalten: 1= Siebert, 2= Pieper, 3= Klippenstein.
Am 18.3.1906 hatten 5 junge Männer gegen 15 Uhr bei dem Bootsverleiher Max Siebert an der dortigen Badeanstalt ein Fünfsitzerboot gemietet. Die Wellen des Tegeler Sees gingen recht hoch. Zwischen Reiherwerder und Hasselwerder wollte einer der Ruderer das Steuer übernehmen. Obwohl das leichte Fahrzeug schon stark schwankte, erhob er sich von seinem Platz. Das Boot schlug um, alle Personen stürzten in die Fluten. Der Vorgang wurde vom Dampfer „Neptun“ aus beobachtet. Der Führer des Dampfers steuerte sofort der Unglücksstelle zu. Doch es konnte nur der 19 Jahre alte Arbeiter Hinze gerettet werden, der sich am Rand des gekenterten Bootes festgehalten hatte. Die anderen 4 jungen Männer ertranken. Auguste Siebert musste, so der Haushaltsplan 1914 der Gemeinde Tegel, 100 M. für das Auflegen eines Zugangsweges zur Badeanstalt und zu den Booten bezahlen. Der Bootsverleiher Max Siebert hatte eine Anerkennungsgebühr von 50 M. für einen Bootssteg auf das Ufergelände des Tegeler Sees an die Gemeinde zu entrichten.
Als am 2.8.1914 der Weltkrieg begann, wurde der Bademeister der Siebertschen Badeanstalt sogleich als Soldat eingezogen. Ein zu dieser Zeit Jugendlicher berichtete, dass er deshalb nach zwei Unterrichtsstunden seine Schwimmübungen allein im Tegeler Fließ fortsetzen musste. Er erinnerte sich auch daran, dass von der Badeanstalt aus im Sommer Bigalkes Motorboot bis zu 20 Personen nach Hasselwerder brachte. Die Siebertsche Badeanstalt bestand wohl bis zum Jahre 1920.
 Blicken wir nun zur Badeanstalt von Carl Pieper, die einst gut 350 m von der zuvor betrachteten Einrichtung entfernt dort lag, wo die Veitstraße am Tegeler See endete. Über diese Badeanstalt kann mehr berichtet werden. Carl Pieper erblickte in Nakel / Netze, einer Stadt im Regierungsbezirk Bromberg, das Licht der Welt. Als Baggermeister kam er 1895 nach Tegel, um im Dienst der Firma Borsig deren Ablage und Hafen zu bauen.
Blicken wir nun zur Badeanstalt von Carl Pieper, die einst gut 350 m von der zuvor betrachteten Einrichtung entfernt dort lag, wo die Veitstraße am Tegeler See endete. Über diese Badeanstalt kann mehr berichtet werden. Carl Pieper erblickte in Nakel / Netze, einer Stadt im Regierungsbezirk Bromberg, das Licht der Welt. Als Baggermeister kam er 1895 nach Tegel, um im Dienst der Firma Borsig deren Ablage und Hafen zu bauen.
Später war er für die Gemeinde Tegel mit der Anlage der Uferpromenade beschäftigt, wobei es allerdings zu Problemen kam, auf die hier nicht näher eingegangen wird. 1897 entschied sich Pieper, hier eine Badeanstalt zu errichten. Die Konzession hierfür war kein Problem. Eine schnelle Ausführung führte dazu, dass noch im Sommer des genannten Jahres der Badebetrieb aufgenommen wurde. Schnell entwickelte sich ein „idyllisches“ Bad mit Besuchern aus Tegel. Aber auch aus Berlin kam „gutes, solides“ Publikum. Künstler des Wintergartens, Bühnenstars besuchten die Badeanstalt, ja, selbst die Operettendiva Fritzi Massary soll hier häufig gebadet haben. Männlein und Weiblein durften hier – wie auch in der Siebertschen Badeanstalt – „nach dem Prinzip des modernen Familienbades“ – hinausschwimmen in die „hohe See“. Allerdings war es in Piepers Badeanstalt schon eine kleine Sensation, dass hier die Bassins für Männer und Frauen nur durch einen Balken, also nicht durch eine sonst übliche Bretterwand getrennt waren. Und die Moral hat davon noch nicht gelitten, schrieb damals eine Zeitung. Die Aufenthalts- und Badesituation bei Pieper änderte sich schlagartig, als die Straßenbahnlinie nach Tegel auf elektrischen Betrieb umgestellt wurde und Berliner Zeitungen vom „Seebad Ostende“, wie Pieper seine Anlage nun nannte, berichteten. Der Name war eine Anspielung auf das mondäne Seebad in Belgien. Jetzt konnten die Großstädter behaupten, für eine Fahrt von anfangs 25 Pf. und dann bald auf 10 Pf. reduziert im „Seebad Ostende“ gewesen zu sein. Bereits ab Juli 1900, dem Zeitpunkt des Beginns des elektrischen Betriebes der Straßenbahn, wanderten an schönen Sonntagen große Menschenmengen von der Straßenbahnhaltestelle Veitstraße zur Pieperschen Badeanstalt. Das Bad war nun nicht mehr wiederzuerkennen.
Tätowierte Burschen, „ebenso dunkel im Ruf – soweit man von einem solchen überhaupt noch sprechen konnte – wie im Aussehen“ bevölkerten die Badeanstalt. Niemand war vor ihnen sicher. Etwa acht Polizisten, die mobil gemacht wurden, konnten nichts ausrichten. Sie konnten ja nicht „blankziehen“, und Gummiknüppel hatten sie damals noch nicht. Es wurde so schlimm, „dass ein anständiger Mensch die Badeanstalt nicht mehr betreten konnte“. Pieper griff zur Selbsthilfe. Er stellte 12 „stabile“ Schifferjungen aus Friedrichsthal bei Oranienburg ein, die sonst Baggerarbeiten am Tegeler Strand verrichteten, stattete sie mit Gummiknüppeln aus und schuf damit eine eigene „Badepolizei“. Eine Woche lang gab es „Wichse“. Das wirkte Wunder. Die „schweren Jungs“ aus Berlin blieben fern, nun konnten wieder die „anständigen Menschen“ im Tegeler See baden.
Am 30.8.1907 nahm sich ein etwa 31 Jahre alter Mann im Tegeler See das Leben. Beim Bootsverleih von Pieper hatte er ein Ruderboot gemietet. Er fuhr längere Zeit auf dem See umher und sprang dann in der Nähe der Insel Hasselwerder ins Wasser und versank in den Fluten. Obwohl Schiffer zur Unfallstelle fuhren und nach dem Mann tauchten, konnte er aber nicht mehr gerettet werden.
Im Februar 1908 unternahm Carl Pieper mit anderen Personen zusammen Rettungsversuche. Der Postschaffner Münde aus der Müllerstraße wollte sich auf der nicht mehr freigegebenen Eisfläche des Tegeler Sees von Tegel nach Saatwinkel begeben. Er brach auf dem Eis ein, rief um Hilfe und versuchte, sich an den immer wieder abbrechenden Eiskanten festzuhalten. Carl Pieper sprang mit anderen Männern zusammen in ein Boot, weil nur so eine Rettung möglich erschien. Diese war sehr schwierig, weil für das Vorankommen immer erst das Eis aufgeschlagen werden musste. Schließlich konnte der Postschaffner in das Boot gezogen und dann zum Paul-Gerhardt-Stift gebracht werden.
Einen wiederholten Selbstmordversuch unternahm im Juni 1908 der Arbeiter R. aus der Brunowstraße. Seiner Frau sagte er, dass er sich das Leben nehmen wolle, weil er keine Arbeit mehr bekäme. Nur mit Hemd und Hose bekleidet, rannte er zum Tegeler See, gefolgt von seiner hilferufenden Frau und anderen Personen. Bei der Pieperschen Badeanstalt sprang er in den See. Drei Ruderer fischten den sich heftig Wehrenden aus dem Wasser und transportierten ihn zur Badeanstalt, wo er behandelt und wieder voll zu Bewusstsein gebracht wurde. Plötzlich stieß er seine Retter beiseite, verließ die Anstalt und sprang wieder ins Wasser. Er wurde erneut gerettet und nun der Polizei übergeben.
Zumindest 1910 nutzte der Tegeler Schwimmverein „Delphin“ Piepers Badeanstalt. Für die Männer-, Jugend- und Schülerabteilung begannen die Übungsstunden dienstags, mittwochs, freitags und sonnabends um 18 Uhr und für die Frauen- und Mädchenabteilung montags und donnerstags ebenfalls um 18 Uhr.

um 1917
„Tegel wird Weltbad“, so die Überschrift eines kleinen Artikels einer Berliner Zeitung im Juli 1913. „Um den nicht in die Sommerfrische gegangenen Einwohnern wenigstens eine Annehmlichkeit eines Badelebens zu verschaffen, hat die Gemeindeverwaltung von Tegel beschlossen, das Strandbild am Tegeler See durch Aufstellung von vermietbaren Strandkörben interessanter zu gestalten“. Auf dem Spielplatz vor der Badeanstalt von Pieper wurden 3 (!) Strandkörbe aufgestellt. Ein einsitziger Strandkorb kostete 10 Pf. stündlich, 30 Pf. täglich oder 2 M. wöchentlich. Der Strandkorb für zwei Personen war beim Parkwächter in den Anlagen mit 15 Pf., 50 Pf. bzw. 3 M. zu bezahlen. „Es fehlen nur noch die Strandkapelle sowie die Einführung einer Kurtaxe, um aus Tegel ein Heringsdorf zu machen“. So einfach erschien also damals der Weg zu einem Weltbad. 1914 erwartete die Gemeinde Tegel in ihrem Haushaltsplan immerhin Einnahmen von 200 M. für das Vermieten von „Strandzelten“, wobei mit diesem Wort sicher die jetzt vermehrt aufgestellten Strandkörbe gemeint waren. Später, u. a. am 12.5.1922, schrieb die Parkverwaltung die Verpachtung der „Strandzelte“ zum Zwecke der Vermietung durch Privatpersonen aus. Bewerbungen von Kriegsbeschädigten erhielten den Vorrang. Auch Carl Pieper musste wie Auguste Siebert an die Gemeinde Tegel einen jährlichen Betrag entrichten. Seine Anerkennungsgebühr für das Auflegen eines Zugangssteges zur Badeanstalt, Restauration und zu den Motor- und Ruderbooten betrug 1914 300 M. Die Badeanstalt wurde im Frühjahr 1926 abgerissen und „verlegt“, weil an dieser Stelle durch die Firma Borsig ein Dammbau „quer durch den Tegeler See“ bis zur Gasanstalt hin aufgeschüttet werden sollte, der im Juni 1926 schon „ziemlich weit fortgeschritten“ war. Später sollte am bisherigen Standort der Badestelle eine neue Anlage „mit allen zeitgemäßen Einrichtungen“ entstehen. Dazu sollte es jedoch nie kommen.

 Erwähnt sei noch, dass es an der Uferpromenade gar eine dritte Badeanstalt gab. Am heutigen Borsighafen gelegen, gehörte sie zum Restaurant „Seeschlößchen“, das Julius Klippenstein besaß. Die Gaststätte musste in Folge des ersten Weltkrieges schließen. Über die Badeanstalt sind keine Einzelheiten bekannt.
Erwähnt sei noch, dass es an der Uferpromenade gar eine dritte Badeanstalt gab. Am heutigen Borsighafen gelegen, gehörte sie zum Restaurant „Seeschlößchen“, das Julius Klippenstein besaß. Die Gaststätte musste in Folge des ersten Weltkrieges schließen. Über die Badeanstalt sind keine Einzelheiten bekannt.
Wir betrachten nun die Städtische Badeanstalt Tegel, die etwa 200 m nördlich der im Abbruch befindlichen Badeanstalt von Pieper entstand. Bei dem „Neubau“ wurde die Materialien der Pieperschen Anlage wieder verwendet. Insofern wurde die alte Einrichtung im allerdings erweiterten Umfang an neuer Stelle wieder aufgestellt. Für Damen und Herren entstanden je 15 x 27 m große Badebecken, während ein drittes Becken mit 20 x 27 m besonders groß für Kinder (Schwimmer und Nichtschwimmer) zur Ausführung kam. Die Badefläche betrug insgesamt 2000 m². Vor den Badebecken entstanden Einzelzellen, ausreichende Umkleideräume mit Kleiderablagen und ein Erfrischungsraum. Der Boden der Badebecken wurde anfangs durch Ausbaggerung von allen Verschmutzungen gesäubert und anschließend mit reinem Flusssand aufgeschüttet. Ein farbiger Anstrich des Bauwerks vermittelte den Eindruck eines Neubaus, der sich „harmonisch in die schöne Landschaft einfügte“. Da die Arbeiten des Bezirks-Hochbauamtes „aufs Eifrigste“ betrieben wurden, konnte die Städtische Badeanstalt Tegel bereits am 15.6.1926 ihren Badebetrieb aufnehmen. Pächter der Anstalt wurde – Carl Pieper! Zur Aufstellungen über die Eintrittspreise ist ergänzend zu erwähnen, dass Erwerbslose werktags von 13 – 1630 Uhr die Bäder in der Flußbadeanstalt Tegel, wie sie auch genannt wurde, kostenlos besuchen konnten.

 Schon bald mussten morsche Bretter, die ja noch von der alten Badeanstalt stammten, ausgetauscht werden. Es erfolgte aber keine vollkommene Erneuerung des Fußbodens, so dass im März 1929 eine Zeitung die Befürchtung äußerte, dass Besucher durch die morschen Bodenbretter brechen könnte. Zumindest ab 1933 war der Gastwirt Max Hempel Pächter der Städtischen Badeanstalt Tegel,
Schon bald mussten morsche Bretter, die ja noch von der alten Badeanstalt stammten, ausgetauscht werden. Es erfolgte aber keine vollkommene Erneuerung des Fußbodens, so dass im März 1929 eine Zeitung die Befürchtung äußerte, dass Besucher durch die morschen Bodenbretter brechen könnte. Zumindest ab 1933 war der Gastwirt Max Hempel Pächter der Städtischen Badeanstalt Tegel,  bis sie 1936 abgerissen wurde. Damit endete die Möglichkeit, an der Uferpromenade in einer Badeanstalt baden zu gehen. Ob hier danach noch „frei“ gebadet wurde, ist nicht überliefert.
bis sie 1936 abgerissen wurde. Damit endete die Möglichkeit, an der Uferpromenade in einer Badeanstalt baden zu gehen. Ob hier danach noch „frei“ gebadet wurde, ist nicht überliefert.
Wir blicken nun zur Liepe, der vielleicht unter diesem Namen weniger bekannten Bucht des Tegeler Sees. Sie grenzt an die Halbinsel Reiherwerder, auch das Forsthaus Tegelsee ist nicht weit entfernt. Hier befindet sich ja auch heute noch eine kleine Badestelle. In welchem Zeitraum hier das Freibad Tegel bestand, ließ sich bisher nicht eindeutig ermitteln. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahre 1928 erwähnt in diesem Zusammenhang einen uns nun schon bekannten Namen: Carl Pieper. Er richtete mit Motorbooten vor dem ersten Weltkrieg eine Überfahrt-Möglichkeit zur Liepe ein. Im dortigen Freibad herrschten „tolle Zustände“, wie sie Pieper bereits in seinem „Seebad Ostende“ kannte. 18 Polizisten in Zivil sollen hier ein halbes Jahr lang Ordnung gehalten haben, um dann machtlos zu sein. „Rüpelhafter Terror“ setzte ein, bis Pieper die Haupträdelsführer aus der Schlägerkolonne zur Aufrechterhaltung der Ordnung anwarb. Schnell herrschte fortan Ruhe.  Der Badebetrieb entwickelte sich jetzt so gut, dass an heißen Sommersonntagen des Jahres 1910 etwa 15000 (?) Personen mit drei Motorbooten nach dem Bad übergesetzt wurden. Dieser Betrieb musste dann unerwartet eingestellt werden. Eine Begründung hierfür ist im oben erwähnte Zeitungsartikel aber nicht schlüssig. Dort wird berichtet, dass nach dem Krieg der bekannte Zweckverband, der Vorläufer der Eingemeindung, entstand und dem Tegeler Bademeister (Pieper) die Bootsanlegestellen entzog. Der Zweckverband entstand bereits 1912, der Krieg begann 1914 und die Eingemeindung erfolgte 1920. Dass bereits der Zweckverband zu einer Einstellung des Motorbootverkehrs führte, ist eher unwahrscheinlich.
Der Badebetrieb entwickelte sich jetzt so gut, dass an heißen Sommersonntagen des Jahres 1910 etwa 15000 (?) Personen mit drei Motorbooten nach dem Bad übergesetzt wurden. Dieser Betrieb musste dann unerwartet eingestellt werden. Eine Begründung hierfür ist im oben erwähnte Zeitungsartikel aber nicht schlüssig. Dort wird berichtet, dass nach dem Krieg der bekannte Zweckverband, der Vorläufer der Eingemeindung, entstand und dem Tegeler Bademeister (Pieper) die Bootsanlegestellen entzog. Der Zweckverband entstand bereits 1912, der Krieg begann 1914 und die Eingemeindung erfolgte 1920. Dass bereits der Zweckverband zu einer Einstellung des Motorbootverkehrs führte, ist eher unwahrscheinlich.
 Im September 1915 wurde das Baden im Tegeler See außerhalb der zugelassenen Badeanstalten und Freibäder auch auf der Strandfläche, die 50 m nördlich des Landvorsprungs gegenüber der Insel Scharfenberg (Scharfenberger Enge) begann und mit dem Aufhören des Altholzbestandes ihr Ende fand, bis auf weiteres verboten. Am 24.6.1920 berichtete eine Zeitung über eine Sitzung der Tegeler Gemeindevertreter: Für das Freibad am Tegeler See werden die Mittel bewilligt. Es soll verlegt und noch vor Beginn der Ferien eröffnet werden. Schon am 9.7.1920 war dann zu lesen:
Im September 1915 wurde das Baden im Tegeler See außerhalb der zugelassenen Badeanstalten und Freibäder auch auf der Strandfläche, die 50 m nördlich des Landvorsprungs gegenüber der Insel Scharfenberg (Scharfenberger Enge) begann und mit dem Aufhören des Altholzbestandes ihr Ende fand, bis auf weiteres verboten. Am 24.6.1920 berichtete eine Zeitung über eine Sitzung der Tegeler Gemeindevertreter: Für das Freibad am Tegeler See werden die Mittel bewilligt. Es soll verlegt und noch vor Beginn der Ferien eröffnet werden. Schon am 9.7.1920 war dann zu lesen:
Tegel. Ein Freibad. Die Gemeindeverwaltung hat sich wegen der vielen Todesfälle durch Ertrinken entschlossen, ein Freibad einzurichten. Es befindet sich gegenüber der Insel Scharfenberg, unweit Tegelort. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 30 Pf., für Kinder 15 Pf. Unglücksfälle dürften hier vermieden werden können, da Badewärter mit Rettungsbällen zur Stelle sind. Außerdem sind Garderoben dort, ähnlich wie im Freibad Wannsee. Das Publikum wird im eigenen Interesse gebeten, an verbotenen Stellen nicht zu baden, sondern das Freibad zu benützen.
Damit gab es im Juli 1920 bereits ein Freibad an jener Stelle, an der später, wie noch zu berichten sein wird, das Strandbad Tegelsee entstand. Zur Badesaison 1921 wurde das Freibad Tegel an der Scharfenberger Enge durch Hinzunahme weiteren Ufergeländes so vergrößert, dass es eine Badefront von 450 m und eine Fläche von 2 Hektar hatte und damit selbst bei stärkstem Andrang allen Besuchern reichlich Bewegungsfreiheit gestattete. Der Eintrittspreis betrug jetzt für Erwachsene 50 Pf. und für Kinder 25 Pf., bei klassenweisem Besuch „unter Führung“ nur 10 Pf.
1922 eröffnete das Freibad am 25.5. seinen Betrieb. Inflationsbedingt lagen die Eintrittspreise jetzt bei 1 M. für Erwachsene und 50 Pf. für Kinder. Für Schulklassen blieb es bei 10 Pf. je Kind. Das Bad war mit der Straßenbahn (Linie 25: Charlottenstraße – Tegelort, Haltestelle Habicht) und einem Fußweg von 10 Minuten „auf herrlichem Waldwege“ zu erreichen. Auch der Wasserweg von Tegel war eine „bequeme Fahrgelegenheit“. Das Freibad Tegel als „Vorläufer“ des Strandbads Tegelsee war im Mai 1923 bereits vom Erdboden verschwunden, weil schon 1922 mehr Menschen außerhalb als innerhalb des Freibades badeten. Der Haushaltsplan 1927 sah für den Verwaltungsbezirk Reinickendorf 75000 RM als erste Baurate für die Errichtung eines Freibades am Tegeler See vor. Mit dem Bau wurde jedoch nicht begonnen.
 In unserem Rückblick besuchen wir jetzt den Zeltlagerverein „Tegelsee“, eine Zelt-Kolonie, die 1918 im Abschnitt zwischen der Bucht Liepe und dem zuvor beschriebenen Freibad Tegel am Wald- und Wasserrand entstand. Von einem leichten Zaun umgeben, standen hier im August 1922 vom Frühjahr bis zum Herbst 25 – 30 Zelte von der einfachen Dreieckform bis zu den senkrechten Wänden und dem besonderen Dach. Einem Teil der Zeltstoffe sah man noch an, dass sie aus Heeresbeständen stammten. Die ein- oder zweistöckigen Bettstellen, je nach Personenzahl, bestanden aus Latten oder Brettern, hatten Drahtböden und einfachen Matratzen. Wolldecken ersetzten die Federbetten. Ein Tisch, ein paar Stühle und der notwendigste Hausrat gehörten zur weiteren Ausstattung. Kleine, alle gleich aussehende braun lackierte Kochherde mit einem etwa 2 m hohen Rauchabzugsrohr standen abseits am Wasserrand. Wurde es kalt, dienten sie nach Entfernung des Rohres im Zelt als Wärmequelle.
In unserem Rückblick besuchen wir jetzt den Zeltlagerverein „Tegelsee“, eine Zelt-Kolonie, die 1918 im Abschnitt zwischen der Bucht Liepe und dem zuvor beschriebenen Freibad Tegel am Wald- und Wasserrand entstand. Von einem leichten Zaun umgeben, standen hier im August 1922 vom Frühjahr bis zum Herbst 25 – 30 Zelte von der einfachen Dreieckform bis zu den senkrechten Wänden und dem besonderen Dach. Einem Teil der Zeltstoffe sah man noch an, dass sie aus Heeresbeständen stammten. Die ein- oder zweistöckigen Bettstellen, je nach Personenzahl, bestanden aus Latten oder Brettern, hatten Drahtböden und einfachen Matratzen. Wolldecken ersetzten die Federbetten. Ein Tisch, ein paar Stühle und der notwendigste Hausrat gehörten zur weiteren Ausstattung. Kleine, alle gleich aussehende braun lackierte Kochherde mit einem etwa 2 m hohen Rauchabzugsrohr standen abseits am Wasserrand. Wurde es kalt, dienten sie nach Entfernung des Rohres im Zelt als Wärmequelle.
 Am Eingang des Zeltplatzes trug eine Holztafel die Inschrift Zeltlagerverein „Tegelsee“. Die Zeltsiedlung war polizeilich genehmigt, die Plätze wurden von der Forstverwaltung angewiesen. Die Gebühr für einen Zeltschein betrug hier 15 M., eine Berechtigung für das Sammeln von dürrem Holz kostete 12 M. Beide Scheine stellte die Oberförsterei Saatwinkel aus. Zum Zeltschein ist noch zu bemerken, dass eine Verordnung aus der Zeit um 1907 bereits festlegte, dass für das Zelten an den Ufern der märkischen Gewässer eine Genehmigung erforderlich war. Der Zeltschein galt in ganz Brandenburg für ein Jahr und kostete 1927 2 M. Wurde vielleicht anfangs nur das Wochenende unter dem Zeltdach verbracht, dann schloss man am Sonntag abends die Zelttür ab und bat den Nachbarn um Bewachung. Für Frauen und Kinder entstand oft auch ein durchgehender Sommeraufenthalt. Der Mann nahm in der Frühe ein Bad im Tegeler See und fuhr dann mit der Straßenbahn zur Arbeit. Die Frau ging auf Waldwegen nach Tegel, um Lebensmittel einzukaufen, sofern sie der Mann nicht aus Berlin mitbrachte. Kam dieser gegen 17 Uhr zum Zeltplatz zurück, war die warme Mahlzeit schon vorbereitet. Waren einmal alle Zeltbewohner abwesend, dann wurde ein Wächter aufgestellt, der dadurch seinen Sommeraufenthalt gratis hatte und noch etwas Geld bekam. Für Fahrten nach Tegel wurden auch Fahrräder gern benutzt. Vom sogenannten Freibad aus, das wie berichtet bis 1922 bestand, konnte man sich zudem für 15 Pf. mit dem Motorboot nach Tegel bringen lassen.
Am Eingang des Zeltplatzes trug eine Holztafel die Inschrift Zeltlagerverein „Tegelsee“. Die Zeltsiedlung war polizeilich genehmigt, die Plätze wurden von der Forstverwaltung angewiesen. Die Gebühr für einen Zeltschein betrug hier 15 M., eine Berechtigung für das Sammeln von dürrem Holz kostete 12 M. Beide Scheine stellte die Oberförsterei Saatwinkel aus. Zum Zeltschein ist noch zu bemerken, dass eine Verordnung aus der Zeit um 1907 bereits festlegte, dass für das Zelten an den Ufern der märkischen Gewässer eine Genehmigung erforderlich war. Der Zeltschein galt in ganz Brandenburg für ein Jahr und kostete 1927 2 M. Wurde vielleicht anfangs nur das Wochenende unter dem Zeltdach verbracht, dann schloss man am Sonntag abends die Zelttür ab und bat den Nachbarn um Bewachung. Für Frauen und Kinder entstand oft auch ein durchgehender Sommeraufenthalt. Der Mann nahm in der Frühe ein Bad im Tegeler See und fuhr dann mit der Straßenbahn zur Arbeit. Die Frau ging auf Waldwegen nach Tegel, um Lebensmittel einzukaufen, sofern sie der Mann nicht aus Berlin mitbrachte. Kam dieser gegen 17 Uhr zum Zeltplatz zurück, war die warme Mahlzeit schon vorbereitet. Waren einmal alle Zeltbewohner abwesend, dann wurde ein Wächter aufgestellt, der dadurch seinen Sommeraufenthalt gratis hatte und noch etwas Geld bekam. Für Fahrten nach Tegel wurden auch Fahrräder gern benutzt. Vom sogenannten Freibad aus, das wie berichtet bis 1922 bestand, konnte man sich zudem für 15 Pf. mit dem Motorboot nach Tegel bringen lassen.
Erwähnt sei noch, dass es schon im Mai 1914 durch eine Polizeiverordnung verboten war, außerhalb der zugelassenen Badeanstalten und Freibäder vom Ufer aus zu baden. Selbst am Ufer war der Aufenthalt in Badebekleidung oder gar unbekleidet verboten. Das galt auch bei einem Aufenthalt in Booten. Dass diese Verordnung kaum beachtet und selten durchgesetzt wurde, muss sicher nicht extra hervorgehoben werden. Ab 1.11.1922 war dann im Prinzip alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten war.
 Im Januar 1932 erfuhren Zeitungsleser, dass „einem von dem Bezirksamt vorgelegten Vertrage betreffs Errichtung eines Freibades am Tegeler See an der Scharfenberger Enge zugestimmt wurde. Da die Zustimmung der zentralen Behörden erfolgen wird, erscheint die Errichtung des Freibades, wenn auch vorläufig noch von privater Seite, gesichert“.
Im Januar 1932 erfuhren Zeitungsleser, dass „einem von dem Bezirksamt vorgelegten Vertrage betreffs Errichtung eines Freibades am Tegeler See an der Scharfenberger Enge zugestimmt wurde. Da die Zustimmung der zentralen Behörden erfolgen wird, erscheint die Errichtung des Freibades, wenn auch vorläufig noch von privater Seite, gesichert“.
Den Auftrag für die Errichtung des Bades erhielt eine Hoch- und Tiefbaufirma aus Schmargendorf, die mit der Ausführung der Arbeiten in der letzten Juni-Woche des genannten Jahres begann. „Mit Volldampf“ machten sich über 100 Arbeiter, teils mit Überstunden, an das Werk. Mitte Juli 1932 hatte das Gelände von der Scharfenberger Enge ostwärts verlaufend eine Wasserfront von 500 m. Die zuvor beschriebene Zeltstadt wurde mit einbezogen. Die Grundstückstiefe reichte bis zum Schwarzen Weg. Ein hoher Zaun umgab das Bad bereits. Einige Bäume wurden schon entfernt, andere waren noch zur Fällung vorgesehen.
Heiße Sommertage sorgten für viel Schweiß beim Planieren des Geländes. Zwei Kassenhäuschen in der Mitte der Geländefront, zwei massive einstöckige Hallen mit Flachdach in 30 m Länge und 10 m Breite mit je 80 Umkleidekabinen, ein massives Toilettengebäude und einige hölzerne Verkaufsbuden, hellgelb und dunkelrot angestrichen, das waren die bereits bestehenden Bauten. In der Grundstücksmitte sollte noch ein provisorisches Wirtschaftsgebäude entstehen, das im Herbst einem massiven Bau weichen sollte.
Für den Nichtschwimmerbereich waren Mitte Juli Bojen zur Abgrenzung vorhanden, jedoch noch nicht ausgelegt. Dies war besonders wichtig, weil hier in der Vergangenheit viele Badende ertranken. Zum Personal des Bades gehörten zwei Bademeister und drei Rettungsschwimmer. Zudem war eine Station der Saatwinkler Arbeitersamariter im Bad geplant. Nach dem Zeitungsartikel v. 17.7.1932, dem die zuvor genannten Informationen entnommen wurden, sollte „ am Sonntag1 nun die provisorische Eröffnung des Bades sein, dessen sich der Berliner nach Fertigstellung wahrlich nicht zu schämen braucht“.
 Eine Woche später berichtete dieselbe Zeitung, dass das Freibad Tegelsee in 10 bis 14 Tagen vollendet sein wird und dann völlig der Öffentlichkeit übergeben werden könne. Die Bojen waren schon ausgelegt, eine Kabinenhalle bereits fertig und in Nutzung. Noch waren Arbeiter im Bad beschäftigt. An einem Freitag2 Nachmittag erfolgte die baupolizeiliche Abnahme des Strandbades Tegelsee durch das Bezirksamt Reinickendorf. Diese Handlung war die offizielle Eröffnung des Strandbades, wobei zu bemerken ist, dass der 5.8.1932 ausgerechnet der letzte Ferientag in Berlin war. Zu diesem Zeitpunkt waren bis auf einen kleinen Rest alle Planierungsarbeiten beendet. Auf dem Strand mit seinem hellen Sand standen Strandkörbe und Liegestühle. Hellfarbige Bojen trugen die Aufschrift „Grenze für Nichtschwimmer“, während 100 m vom Ufer entfernt die Bojen mit der Aufschrift „Grenze des Strandbades Tegel“ den
Eine Woche später berichtete dieselbe Zeitung, dass das Freibad Tegelsee in 10 bis 14 Tagen vollendet sein wird und dann völlig der Öffentlichkeit übergeben werden könne. Die Bojen waren schon ausgelegt, eine Kabinenhalle bereits fertig und in Nutzung. Noch waren Arbeiter im Bad beschäftigt. An einem Freitag2 Nachmittag erfolgte die baupolizeiliche Abnahme des Strandbades Tegelsee durch das Bezirksamt Reinickendorf. Diese Handlung war die offizielle Eröffnung des Strandbades, wobei zu bemerken ist, dass der 5.8.1932 ausgerechnet der letzte Ferientag in Berlin war. Zu diesem Zeitpunkt waren bis auf einen kleinen Rest alle Planierungsarbeiten beendet. Auf dem Strand mit seinem hellen Sand standen Strandkörbe und Liegestühle. Hellfarbige Bojen trugen die Aufschrift „Grenze für Nichtschwimmer“, während 100 m vom Ufer entfernt die Bojen mit der Aufschrift „Grenze des Strandbades Tegel“ den  Schwimmern Halt geboten. Die Wassertiefe lag zwischen 4 und 8 m. Ein „Pier“ reichte über die Nichtschwimmergrenze hinaus. Am Ende war ein 4 m hoher Wachtturm für den Bademeister mit einem Ausblick zu allen vier Seiten. Am Steg lag ein Rettungskahn, der bei Bedarf von den dem Bademeister unterstehenden Rettungsschwimmern genutzt wurde. Die großen Hallen mit ihren je 40 Dauer- und Wechselkabinen waren vollendet. 30 große Papierkörbe seien noch erwähnt. Es ist durchaus nicht übertrieben, wenn man dieses Strandbad das schönstgelegene aller Berliner Freibäder und ein Schmuckstück unseres Nordens nennt. So das damalige Lob einer Zeitung.
Schwimmern Halt geboten. Die Wassertiefe lag zwischen 4 und 8 m. Ein „Pier“ reichte über die Nichtschwimmergrenze hinaus. Am Ende war ein 4 m hoher Wachtturm für den Bademeister mit einem Ausblick zu allen vier Seiten. Am Steg lag ein Rettungskahn, der bei Bedarf von den dem Bademeister unterstehenden Rettungsschwimmern genutzt wurde. Die großen Hallen mit ihren je 40 Dauer- und Wechselkabinen waren vollendet. 30 große Papierkörbe seien noch erwähnt. Es ist durchaus nicht übertrieben, wenn man dieses Strandbad das schönstgelegene aller Berliner Freibäder und ein Schmuckstück unseres Nordens nennt. So das damalige Lob einer Zeitung.
In der Folgezeit gingen Arbeiten zum Ausbau des Strandbades weiter. Mitte April 1933 waren sie bis auf Kleinigkeiten vollendet. Eine offizielle (erneute) Eröffnung war für Mitte Mai des Jahres geplant. Licht-, Luft- und Sonnenbäder konnten schon unentgeltlich eingenommen werden. Im Herbst 1932 wurde die Zeltstadt vom Strandbad-Gelände entfernt. Der Nichtschwimmerbereich erfuhr durch Aufschüttung von 50 Kahnladungen Sand auf den Seeboden eine erhebliche Vergrößerung auf jetzt 60 m im Wasser. Schon 1932 hatte man festgestellt, dass sich an hier von 90 cm auf 1,60 m ab. Mit Hilfe eines selbst gebauten Floßes wurde Sand herbeigeschafft und dem Übel damit kurzfristig abgeholfen.
Gleich hinter dem „Schloßrestaurant“ (Restaurant Alter Fritz) zeigte ein Wegweiser an:„Zum Strandbad Tegelsee“. Die Straßenbahn nach Tegelort erhielt an der Haltestelle „Habicht“ den Zusatztitel „ Haltestelle Strandbad Tegelsee“, der auch vom Schaffner mit ausgerufen wurde.
 Erster Pächter des Strandbades Tegelsee mit seinen 36000 m² Gelände war Paul Willner. Er kannte sich in dem Bereich gut aus, war er doch zuvor ab 1920 Revierförster im nahen Forsthaus Tegelsee. 1936 war das Bad von 6 Uhr in der Frühe bis zur Dunkelheit geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene betrug 15 Pf., Kinder zahlten 5 Pf. Das Sprungbrett hatte eine Breite von 2 m, Turngeräte standen zur Verfügung.
Erster Pächter des Strandbades Tegelsee mit seinen 36000 m² Gelände war Paul Willner. Er kannte sich in dem Bereich gut aus, war er doch zuvor ab 1920 Revierförster im nahen Forsthaus Tegelsee. 1936 war das Bad von 6 Uhr in der Frühe bis zur Dunkelheit geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene betrug 15 Pf., Kinder zahlten 5 Pf. Das Sprungbrett hatte eine Breite von 2 m, Turngeräte standen zur Verfügung.

 Am 21.1.1937 beschäftigten sich die Ratsherren der Reichshauptstadt unter der Leitung des Oberbürgermeisters Dr. Lippert in einem Sitzungspunkt mit dem Freibad Tegelsee. Es ging um einen Vergleich mit der Firma Hermann Schäler, jenem Baugeschäft, dass das Strandbad errichtete. Ratsherr Scheller berichtete von einer Übervorteilung, schweren Schädigung und zu befürchtendem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Pächters Willner. Die Frage einer Weiterführung des Strandbades ab 1.4.1938 durch die Stadt Berlin wurde gestellt. Von einer 80000 bis 90000 RM hohen Schadenssumme durch nicht ausgeführte Bauten und minderwertigem Material wurde gesprochen. Mit dem Einvernehmen über einen Vergleich in Höhe von 37000 RM endete dieser Punkt der Sitzung. Willner war wohl bis 1939 Pächter des Strandbades. Als u. a. am 10.3.1940 die Sommerbadeanstalt mit Schankwirtschaftsbetrieb durch das Bezirksamt Reinickendorf neu ausgeschrieben wurde, erhielt des Gastwirt Richard Sprang den Zuschlag. Er musste ein Betriebskapital von circa 12000 RM nachweisen.
Am 21.1.1937 beschäftigten sich die Ratsherren der Reichshauptstadt unter der Leitung des Oberbürgermeisters Dr. Lippert in einem Sitzungspunkt mit dem Freibad Tegelsee. Es ging um einen Vergleich mit der Firma Hermann Schäler, jenem Baugeschäft, dass das Strandbad errichtete. Ratsherr Scheller berichtete von einer Übervorteilung, schweren Schädigung und zu befürchtendem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Pächters Willner. Die Frage einer Weiterführung des Strandbades ab 1.4.1938 durch die Stadt Berlin wurde gestellt. Von einer 80000 bis 90000 RM hohen Schadenssumme durch nicht ausgeführte Bauten und minderwertigem Material wurde gesprochen. Mit dem Einvernehmen über einen Vergleich in Höhe von 37000 RM endete dieser Punkt der Sitzung. Willner war wohl bis 1939 Pächter des Strandbades. Als u. a. am 10.3.1940 die Sommerbadeanstalt mit Schankwirtschaftsbetrieb durch das Bezirksamt Reinickendorf neu ausgeschrieben wurde, erhielt des Gastwirt Richard Sprang den Zuschlag. Er musste ein Betriebskapital von circa 12000 RM nachweisen.
Zu dieser Zeit verfügte das Strandbad im Tegeler Forst Nord, Jagen 65 am Schwarzen Weg, über ein Sprungbrett von 1 m und eine Wassertiefe bis zu 3,50 m. Es war von 7 Uhr morgens bis zum Eintritt der Dunkelheit geöffnet. Der Eintrittspreis lag bei unverändert 15 bzw. 5 Pf. für Erwachsene bzw. Kinder. Sprang blieb über das Kriegsende hinaus bis 1951 Pächter. Vom Folgejahr an war es der Gastwirt Willi Neumann, im Zeitraum von 1962 bis 1973 Gerda Neumann. Auf zeitlich folgende Einzelheiten (weitere Pächter, Übernahme des Strandbades durch die Berliner Bäderbetriebe in den 1990er-Jahren und die zuletzt jahrelange Schließung) wird hier verzichtet. Es bleibt zu hoffen, dass mit der Wiedereröffnung des Bades durch den Verein Neue Nachbarschaft Moabit am 3.6.2021 zu einem späteren Zeitpunkt eine lange erfreuliche Fortschreibung dieses Beitrages möglich wird.

Mai 2021
1 Das Datum hierzu: 17.7.1932
2 Vermutlich Freitag, der 5.8.1932